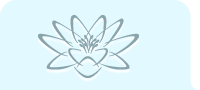Gut zu wissen
Sozialstatus, Bildungsgrad und Geschlecht bestimmen Herz-Kreislaufrisiken
Biologische und psychosoziale Faktoren haben einen hohen Stellenwert bei Menschen mit Diabetes. Bei Menschen mit niedrigem sozialen Status und geringem Bildungsgrad steigt das Risiko diese chronische und fortschreitende Erkrankung zu entwickeln.
Dabei gibt es zusätzlich noch geschlechtsspezifische Unterschiede, referierte die Gender-Medizinern Professorin Dr. Alexandra Kautzky-Willer aus Wien auf dem diesjährigen Diabeteskongress in Leipzig. Der Zusammenhang zwischen einem niedrigen Bildungsgrad und Übergewicht mit Typ 2-Diabetes besteht bei Frauen noch deutlich ausgeprägter als bei Männern. Auch beklagen diese Frauen eine erheblich schlechtere Lebensqualität als die Männer.
Für die Entstehung und den Erkrankungsverlauf eines Typ 2-Diabetes sind neben der genetischen Ausstattung und Veranlagung auch Sexualhormone verantwortlich und auch die Geschlechterrolle, die Gesellschaft und das soziale Umfeld mit der jeweiligen kulturellen Orientierung nehmen Einfluss auf die Erkrankung, so die Gendermedizinerin: Frauen legen ihren Fokus verstärkt auf Diäten und sind mehr an der Prävention interessiert als Männer, die ihr Gesundheitsbewusstsein in körperlicher Aktivität und Sport umsetzen.“ Daraus resultiert ein sehr unterschiedlicher Lebensstil zwischen Frauen und Männern.
Ein niedriger sozialer Status und mangelnde Bildung sind mit einem höheren Risiko für Diabetes verbunden, allerdings ist der Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und Übergewicht bei Frauen deutlich stärker ausgeprägt. Die Unterschiede zwischen der Lebensqualität und dem seelischen Wohlbefinden sind ebenfalls deutlich erkennbar. Dies spiegelt sich darin wider, dass Diabetikerinnen doppelt so häufig unter Depressionen und Essstörungen leiden als Männer mit dieser Stoffwechselerkrankung.
Das Risiko einer Störung im Glukosestoffwechsel wird nach Ansicht der Expertin auch deutlich durch die Sexualhormone, die Gesamtfettmasse des Körpers und das Fettverteilungsmuster beeinflusst. Demnach haben Männer häufiger einen deutlich höheren Anteil an viszeralen Fettmassen, im Bauchraum angesiedeltes Fett), sie weisen eine geringere Insulinsensitivität auf und unterscheiden sich in der Freisetzung der Fettgewebshormone. Daraus resultiert, dass bei Männern das metabolische Syndrom, Bluthochdruck und ein ungünstiges kardiovaskuläres Risiko häufiger gesehen wird als bei Frauen. Im Gegensatz zu dieser Risikokonstellation der Männer sterben Frauen aber häufiger an den Folgen einer kardiovaskulären Erkrankung, wie z.B. am Herzinfarkt. Weisen Frauen ein metabolisches Syndrom oder einen Diabetes auf, bedingt dies ein deutlich höheres kardiovaskuläres Risiko als bei den betroffenen Männern. Die diesen Unterschieden zugrunde liegenden Ursachen sind noch nicht erforscht, es könnte aber zur Aufklärung beitragen, wenn eine Anamnese der Sexualität, der Zyklusanomalien oder Schwangerschaftskomplikationen erhoben würde.
Bei Männern weist meist die erektile Dysfunktion auf ein kardiovaskuläres Risiko, ein metabolisches Syndrom oder einen Diabetes hin. Übergewicht und Insulinresistenz sind bei Männern mit einem Testosteronmangel verbunden, während bei Frauen erhöhte Testosteronwerte (Androgene) das Risiko für einen Diabetes erhöht. Dies spiegelt sich bei dem Phänomen der polyzystischen Ovarien (Eierstockszyten) wider, die bei übergewichtigen und adipösen Frauen vermehrt auftreten und ein erhöhtes Herz-Kreislaufrisiko signalisieren.