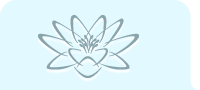Gut zu wissen
Gewichtsreduktion von 30 kg auf konservativem Weg ist eine Illusion
Nahezu 17 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einem Body Mass Index (BMI) jenseits von 30 kg/qm, in der Gesamtbevölkerung gehören 20 Prozent der Männer und 22,5 Prozent der Frauen zu diesem Kollektiv. Etwa 5,3 Millionen Menschen weisen einen BMI oberhalb von 35 kg/qm auf und haben sich damit potentiell für eine Adipositas Chirurgie qualifiziert, wenn sie bereits an einer adipositas-assoziierten Begleiterkrankung leiden.
Da aber in Deutschland die an Adipositas Erkrankten eher verwaltet als behandelt werden, führt die bariatrische Chirurgie hierzulande ein Stiefkind-Dasein im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, etwa der Schweiz (dreimal häufiger) oder Österreich viermal häufiger).
Noch immer steht für die Betroffenen die konservative Behandlung mit Ernährung, Bewegung und Verhaltensänderung im Zentrum der Maßnahmen, die der Betroffene selbstfinanziert und eigenverantwortlich ergreifen soll, weil der Gesetzgeber kaum eine realistische Grundlage geschaffen hat, die zudem noch aussichtslos unterfinanziert ist.
„Bei diesen Patienten ist eine ambulante konservative Therapie schwer umsetzbar“, sagte Professor Plamen Staikov vom Krankenhaus Sachsenhausen in Frankfurt. Dort leitet der die bariatrisch-chirurgische Abteilung und berichtet über die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Diabetologen, Endokrinolgen, Psychologen und Diätberater.
In seinem Vortrag stellte er die Kasuistik von drei Patienten vor, die das aussichtslose Unterfangen konservativer Therapie in solchen „Gewichtsklassen“ unterstreicht. Allem voran stellte er die Definition der krankhaften Adipositas als chronische Erkrankung mit hoher Rezidivneigung, enormer Diabetesprävalenz und multiplen Komorbiditäten seitens der Herz-Kreislaufsituation. Die klinikeigene konservative Gewichtsreduktion einer sechsmonatigen Maßnahme „4activity“ scheitere oft aus Kostengründen.
Die Schilderung typischer Kasuisten von extrem adipösen Patienten macht den Konflikt des Chirurgen mit den realitätsfernen Leitlinien multipler Gesellschaften und der krankenkassenfreundlichen Gesetzgebung deutlich.
Eine direkte Operationsindikation bot ein männlicher Patient, dessen BMI deutlich über 50 kg/qm angekommen war, und ein manifester Diabetes verschärfte das Risikoprofil immens. Gemeinsam mit den Experten des Adipositaszentrum Frankfurt Sachsenhausen wird eine präoperative Risikostratefizierung festgelegt, an der Chirurgen, Diabetologen/Endokrinologen, Psychologen sowie die Vorstellung im Schlaflabor integriert sind. Die individuelle Patientensituation wird der Entscheidung einer Schlauchmagen- oder Magenbypass-Operation zugrunde gelegt. Jede dieser Methoden findet in Deutschland jährlich bei 3.500 Operationen statt. Eine Metaanalyse aus großen klinischen Studien zeigt aber leichte Überlegenheit der Bypassoperation im Vergleich zum Schlauchmagen.
Eine krankhaft adipöse Patientin mit konservativer Therapie hat in 6 Monaten eine Gewichtsreduktion von 6 Kilogramm erreicht, konnte ihren BMI von 45 auf 43 reduzieren, gehört aber immer zum Kollektiv der Adipösen mit hohen Risikofaktoren. „Die Forderung aus den Leitlinien nach eine Gewichtsreduktion von 30 kg auf konservativem Weg ist völlig illusorisch“, sagte Staikov. Mit der bariatrischen Chirurgie konnte diese weibliche Patientin ihrem BMI auf 29,8 senken. Damit war auch die arterielle Hypertonie und der Diabetes mellitus im gesundheitlich gut vertretbaren Bereich, eine nachfolgende plastische Chirurgie befreite sie von ihrer Fettschürze, wodurch das bariatrische Ergebnis nochmals positiv beeinflusst wurde. Einzig ein Bandscheibenschaden trat bei der Patientin auf, der nach Ansicht von Professor Staikov mit dem Verlust an Muskelmasse begründet werden könne, dem durch Bewegung und Supplemtierung frühzeitig begegnet werden müsse.
Der operierte männliche Patient habe zwei Jahre post operationem mehr als 70 kg abgenommen, benötigt keine Antihypertensiva mehr und konnte seine antidiabetische Medikation erheblich reduzieren. Auch die Schlafapnoe und die gastrointestinale Refluxerkrankung waren beseitigt. Störend waren die verbliebene Fettschürze, eine Obstipation, Gallensteine und die Notwendigkeit regelmäßiger Supplementierung von Viatminen, Mineralstoff und Eisen.
Zur Klassifizierung der Adipositas und des Mortalitätsrisikos plädierte Professor Kristian Rett, Chefarzt und Diabetologe des Adipositaszentrums Im Sachsenhäuser Krankenhaus für die Verwendung des Edmonton Obesity Staging, das auch die Begleiterkrank und und Komorbidität des Patienten in unterschiedlichen BMI-Kategorien berücksichtigt. „Adipositas ist weit mehr als ein BMI jenseits von 30“, sagte er und wies auf die 52 Prozent dieses Kollektiv hin, die bereits einen Typ 2-Diabetes rekrutiert haben. Daher gehört die orale Glukosebelastung (IGT) unbedingt zu jeder Diagnostik eines adipösen Patienten. Neben den robusten Adipösen haben mehr als 50 Prozent der Patienten mit der Sensibilität der Betazelle einen Schlüsseldefekt, der unbedingt berücksichtigt und therapiert werden muss. Ideale Diabetesmedikamente vermeiden Hypoglykämie und verhalten sich gewichtsneutral. Metformin und/oder Insulin erhalten fast alle Diabetiker, bei hohem Hypoglykämierisiko kann mit antioroxigenen SGLT2-Inhibitoren ein Glukoseverlust von bis zu 300 mg Glukose durch Glukosurie erreicht werden. Substanzen die den DPP4-Rezeptor inhibieren oder am GLP1-Rezeptor wirken können ebenfalls die Hypoglykämierate herabsetzen. Gewichtsneutralität werde durch die gesteigerte GLP1-Sekretion angestrebt, die appetithemmend wirkt. Immer korreliert die gravierend verbesserte Insulinsensitität mit einer Reduktion von Fettgewebe.
Postoperativ könne durch den sehr schnellen Anstieg des Blutzuckers und vermehrter Insulinfreisetzung eine Hypoglykämie drohen, und daher besteht post-bariatrisch ein extrem starkes Tabu für raffinierte Kohlenhydrate. Durch die verbesserte Antwort des pankreatischen Betazelle nach bariatrischer Chirurgie werde die Hypoglykämie getriggert. Rett wies darauf hin, dass die oft beschriebenen Dumping-Symptome nach Magenbypass nicht selten identisch mit Hypoglykämie-Symtpomen sind und möglicherweise als solche interpretiert werden müssten. Diesem Phänomen kann durch akzentuierte Glukoseaufnahme begegnet werden, jeglicher Vermeidung von Saccharose und der therapeutischen Verwendung der Acarbose, faserreicher Kost und probiotischer Ernährung.